Donnerstag, 1. Februar 2007
Die Entstehung des Faust
faust, 12:27h
Um gleich zu Beginn einen Irrtum zu widerlegen:
Faust entsprang nicht Goethes Gedankengut.
Der historische Faust
Die Person
Es bildeten sich schon etwa dreihundert Jahren vor Goethe Geschichten und Sagen um meinen möglichen Ursprung. Unstimmigkeiten gibt es beim Namen. Man ist ist sich uneinig, ob jener Gelehrte Dr. Faust Johannes oder Georg hieß. Er wurde vermutlich um 1480 in dem württembergischen Städtchen Knittlingen geboren. Dieser Dr. Faust muss schon als dreißigjähriger Mann durch seine Tätigkeit als Arzt, Alchemist und Astrologe weithin bekannt gewesen sein.
Schon zu seiner Lebzeit hat die Sagenbildung begonnen. Er sagte über sich selbst, dass er ein "Meister in der Zauberei" und "Herr über geheime Kräfte" sei. Er soll sich sogar einen "Halbgott" genannt haben. Von diesen Gerüchten aus und in Anbetracht der Tatsache, dass Faust 1539 eines unnatürlichen, angeblich übernatürlichen Todes starb, war der Schritt nicht mehr weit, dem "Schwarzkünstler" einen Pakt mit dem Teufel anzudichten.
Ursprüngliche Bedeutung
Die Menschen in dieser Zeit formten über die Jahre einen regelrechten Faustmythos, der zu großen Teilen seine Entstehung in der Unaufgeklärtheit von Zeit und Leuten hatte.
Von Seiten der Kirche wurde Faust stets als Warnbeispiel angeführt. Sie verurteilte seine Beschäftigung mit schwarzen Künsten und der Theosophie (= "Göttliche Weisheit"), d.h. der selbständigen Suche nach dem Gottesbegriff. Philipp Melanchthon rief ihm sogar nach, "der Teufel selbst" zu sein.
Faust als Dramenheld
Die Denkströmungen der Reformation und der Renaissance förderten die Entwicklung meiner Geschichte. So galt in der Renaissance des allseitig gebildeten Menschen, der seine Persönlichkeit selbst formte und einen individuellen Charakter hatte, als Idealbild. Meine historische Person sollte diesem Idealbild entsprechen, weil sie sich über die Bevormundung des althergebrachten, kirchlichen Denkens hinwegsetzte und durch Forschen vor allem in dem Bereich der Alchemie für beachtliches Aufsehen sorgte. Sie wurde im Volke bald zum "Sinnbild menschlichen Erkenntnisstrebens".
Doch in Wahrheit habe ich gar nicht so sehr diesem Idealbild entsprochen.
 Zwar muss ich stets von Unruhe und Unzufriedenheit gequält gewesen sein, doch meine Ziele waren vielmehr die Befriedigung meiner Neugier und die Suche nach Wissen allein aus einem gewissen "Machtstreben" heraus. Dem Ideal eines Humanisten hätten damals vielmehr Luther, Kolumbus oder Michelangelo entsprochen.
Zwar muss ich stets von Unruhe und Unzufriedenheit gequält gewesen sein, doch meine Ziele waren vielmehr die Befriedigung meiner Neugier und die Suche nach Wissen allein aus einem gewissen "Machtstreben" heraus. Dem Ideal eines Humanisten hätten damals vielmehr Luther, Kolumbus oder Michelangelo entsprochen.
Meine Vorbilder
"Historia von Dr. Johann Fausten"
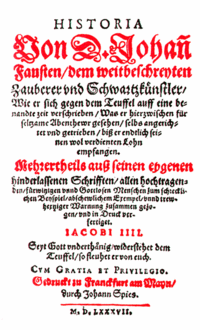
Im Jahre 1587 erschien das erste Volksbuch über mich. Vermutlich schrieb ein abergläubischer Theologe, der durch große Höllenangst gequält wurde, die "Historia von Dr. Johann Fausten". Der Glaube an den Teufel und die Zauberei sind die hervorstechensten mittelalterlichen, inhaltlichen Aspekte. Ein humanistisches Motiv entdeckt man im Wissensdrang meiner Persönlichkeit. Meine Sage verbreitete sich durch dieses Buch und durch die mündliche Überlieferung schnell und drang erstaunlicher Weise sogar bis nach England vor.
"The Tragical History of Doctor Faust" (Marlowe)
Im 16. Jahrhundert hatten sich bereits einige wenige, eher unbedeutende Dichter mit meiner Person befasst. Sie waren allerdings nie in der Lage ein zusammenhängendes Theaterstück schreiben.
Erst der Engländer Christopher Marlowe (1564 - 1593) vollendete im Jahre 1589 "The Tragical History of Doctor Faust" als zusammenhängende Tragödie.
Marlowe stellt mich in seiner Tragödie als macht- und sinnlichkeitsversessenen Mann dar, der sich zu antichristlichem Handeln verleiten lässt. Ich treffe mit dem Teufel die Abmachung, meine Seele gegen 24 Jahre irdisches und genußvolles Leben einzutauschen. Dadurch soll meine Seele dem himmlischen, ewigen Leben nach dem Tod entzogen werden. Da ich nicht an ein Leben nach dem Tod glaube, nehme ich den Verlust meiner Seele hin und schließe den Pakt mit dem Teufel.
Von englischen Schauspieltruppen in Deutschland aufgeführt, verlor das Stück jedoch bald seinen geistig hohen Anspruch. Um das Publikum in Zeiten des Barocks zu fesseln, wurden Passagen verändert oder hinzugefügt. Mein individueller Charakter ging traurigerweise verloren.
Puppenspiel
Einige Teile von Marlowes Tragödie wurden immer wieder als Puppenspiel aufgeführt. Es wird angenommen, dass mein Schöpfer Goethe als kleiner Junge solch eine Puppentheateraufführung gesehen hat und sich seitdem nicht mehr davon lösen konnte.
Der Entwurf meiner Person
Goethes Geisteshaltung zu Beginn meiner Schöpfung
Als maßgeblicher Charakter der Sturm-und-Drang-Zeit vertrat Goethe folgende Geisteshaltung: Er wollte die "Abkehr von den regelgebundenen Dramen der Franzosen hin zum Ausdruck des Natürlichen, im Leben wie in der Dichtung". Natur bedeutete für ihn die Ganzheit des menschlichen Charakters und eine allumfassende Einheit des Universums. Dazu zählte für meinen Schöpfer auch die Aufhebung von Gut und Böse. Der Mensch sollte sich von Heilsversprechen lossagen und realistisch denken, d.h. er sollte sich seinem Schicksal, für das Tod und Untergang charakteristisch sind, bewusst werden.
Meine Urdarstellung
Goethe arbeitete während der Jahre 1768 bis 1775 in Straßbourg und Frankfurt an meiner ersten Fassung und präsentierte Auszüge aus seinem Werk erstmals in Weimar vor einer Hofgesellschaft des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach.

In den Jahren 1777/78 wurde eine Abschrift meiner Urdarstellung (= "Urfaust") veröffentlicht und fand große Beachtung.
Der Handlungsverlauf weichte von der späteren Fassung erheblich ab. Es fehlten mehrere Szenen des ersten Teils (mein zweiter Monolog, "Osterspaziergang", "Hexenküche", "Walpurgisnacht", ...). Der zweite Teil war überhaupt noch nicht vorhanden. Die Tragödie existierte in dieser Form unverändert ca. 10 Jahre.
Ein Teil nach dem anderen...
An der dramatischen Darstellung meiner Persönlichkeit schrieb Goethe erst 1786 weiter. Er wollte die Tragödie für die Herausgabe einer Werksammlung vollenden, scheiterte aber an diesem Vorhaben. Erst in Italien, wohin er nach zehn Jahren in Weimar aufgebrochen war, fügte er dem Stück wieder mehrere Szenen hinzu. Es entstanden die Szenen "Hexenküche" und "Wald und Höhle". Außerdem wandelte er die Szene "Auerbachs Keller" von der Prosaform (= Darstellung ohne Verse) in die klassische Verssprache um und veränderte die Handlung dieser Szene auf die heutige Fassung. Versuche in den Jahren 1788/89, dieses Werk endgültig abzuschließen, schlugen fehl. Aus diesem Grunde veröffentlichte Goethe 1790 das Werk als Fragment. Danach ließ er es wieder sieben Jahre lang ruhen.
Einfluss Schillers
Erst auf Drängen Schillers hin, mit dem Goethe seit 1794 eine enge Freundschaft geschlossen hatte, verfasste Goethe 1797 die "Zueignung", das "Vorspiel auf dem Theater" und den "Prolog im Himmel".
In Briefen schrieb Schiller an den gemeinsamen Verleger Cotta:"Nun noch einen guten Rat. Ich fürchte, Goethe lässt seinen "Faust", an dem schon so viel gemacht ist, ganz liegen, wenn er nicht von außen und durch anlockende Offerten veranlasst wird, sich noch einmal an diese große Arbeit zu machen und sie zu vollenden ... Sie können ihn, das bin ich überzeugt, durch glänzende Anerbietungen dahin bringen, dieses Werk in diesem Sommer auszuarbeiten..." (24. März 1800)
Doch wieder kam Goethe zu keinem endgültigen Ende. Wenngleich er vermutlich kurz darauf erstmals den Plan fasste, die Dichtung über meine Wenigkeit auf zwei Teile verteilen.
Der historische Faust
Die Person
Es bildeten sich schon etwa dreihundert Jahren vor Goethe Geschichten und Sagen um meinen möglichen Ursprung. Unstimmigkeiten gibt es beim Namen. Man ist ist sich uneinig, ob jener Gelehrte Dr. Faust Johannes oder Georg hieß. Er wurde vermutlich um 1480 in dem württembergischen Städtchen Knittlingen geboren. Dieser Dr. Faust muss schon als dreißigjähriger Mann durch seine Tätigkeit als Arzt, Alchemist und Astrologe weithin bekannt gewesen sein.
Schon zu seiner Lebzeit hat die Sagenbildung begonnen. Er sagte über sich selbst, dass er ein "Meister in der Zauberei" und "Herr über geheime Kräfte" sei. Er soll sich sogar einen "Halbgott" genannt haben. Von diesen Gerüchten aus und in Anbetracht der Tatsache, dass Faust 1539 eines unnatürlichen, angeblich übernatürlichen Todes starb, war der Schritt nicht mehr weit, dem "Schwarzkünstler" einen Pakt mit dem Teufel anzudichten.
Ursprüngliche Bedeutung
Die Menschen in dieser Zeit formten über die Jahre einen regelrechten Faustmythos, der zu großen Teilen seine Entstehung in der Unaufgeklärtheit von Zeit und Leuten hatte.
Von Seiten der Kirche wurde Faust stets als Warnbeispiel angeführt. Sie verurteilte seine Beschäftigung mit schwarzen Künsten und der Theosophie (= "Göttliche Weisheit"), d.h. der selbständigen Suche nach dem Gottesbegriff. Philipp Melanchthon rief ihm sogar nach, "der Teufel selbst" zu sein.
Faust als Dramenheld
Die Denkströmungen der Reformation und der Renaissance förderten die Entwicklung meiner Geschichte. So galt in der Renaissance des allseitig gebildeten Menschen, der seine Persönlichkeit selbst formte und einen individuellen Charakter hatte, als Idealbild. Meine historische Person sollte diesem Idealbild entsprechen, weil sie sich über die Bevormundung des althergebrachten, kirchlichen Denkens hinwegsetzte und durch Forschen vor allem in dem Bereich der Alchemie für beachtliches Aufsehen sorgte. Sie wurde im Volke bald zum "Sinnbild menschlichen Erkenntnisstrebens".
Doch in Wahrheit habe ich gar nicht so sehr diesem Idealbild entsprochen.
 Zwar muss ich stets von Unruhe und Unzufriedenheit gequält gewesen sein, doch meine Ziele waren vielmehr die Befriedigung meiner Neugier und die Suche nach Wissen allein aus einem gewissen "Machtstreben" heraus. Dem Ideal eines Humanisten hätten damals vielmehr Luther, Kolumbus oder Michelangelo entsprochen.
Zwar muss ich stets von Unruhe und Unzufriedenheit gequält gewesen sein, doch meine Ziele waren vielmehr die Befriedigung meiner Neugier und die Suche nach Wissen allein aus einem gewissen "Machtstreben" heraus. Dem Ideal eines Humanisten hätten damals vielmehr Luther, Kolumbus oder Michelangelo entsprochen.Meine Vorbilder
"Historia von Dr. Johann Fausten"
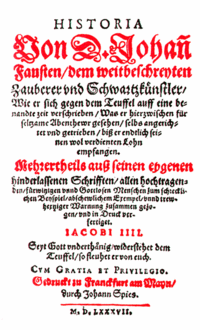
Im Jahre 1587 erschien das erste Volksbuch über mich. Vermutlich schrieb ein abergläubischer Theologe, der durch große Höllenangst gequält wurde, die "Historia von Dr. Johann Fausten". Der Glaube an den Teufel und die Zauberei sind die hervorstechensten mittelalterlichen, inhaltlichen Aspekte. Ein humanistisches Motiv entdeckt man im Wissensdrang meiner Persönlichkeit. Meine Sage verbreitete sich durch dieses Buch und durch die mündliche Überlieferung schnell und drang erstaunlicher Weise sogar bis nach England vor.
"The Tragical History of Doctor Faust" (Marlowe)
Im 16. Jahrhundert hatten sich bereits einige wenige, eher unbedeutende Dichter mit meiner Person befasst. Sie waren allerdings nie in der Lage ein zusammenhängendes Theaterstück schreiben.
Erst der Engländer Christopher Marlowe (1564 - 1593) vollendete im Jahre 1589 "The Tragical History of Doctor Faust" als zusammenhängende Tragödie.
Marlowe stellt mich in seiner Tragödie als macht- und sinnlichkeitsversessenen Mann dar, der sich zu antichristlichem Handeln verleiten lässt. Ich treffe mit dem Teufel die Abmachung, meine Seele gegen 24 Jahre irdisches und genußvolles Leben einzutauschen. Dadurch soll meine Seele dem himmlischen, ewigen Leben nach dem Tod entzogen werden. Da ich nicht an ein Leben nach dem Tod glaube, nehme ich den Verlust meiner Seele hin und schließe den Pakt mit dem Teufel.
Von englischen Schauspieltruppen in Deutschland aufgeführt, verlor das Stück jedoch bald seinen geistig hohen Anspruch. Um das Publikum in Zeiten des Barocks zu fesseln, wurden Passagen verändert oder hinzugefügt. Mein individueller Charakter ging traurigerweise verloren.
Puppenspiel
Einige Teile von Marlowes Tragödie wurden immer wieder als Puppenspiel aufgeführt. Es wird angenommen, dass mein Schöpfer Goethe als kleiner Junge solch eine Puppentheateraufführung gesehen hat und sich seitdem nicht mehr davon lösen konnte.
Der Entwurf meiner Person
Goethes Geisteshaltung zu Beginn meiner Schöpfung
Als maßgeblicher Charakter der Sturm-und-Drang-Zeit vertrat Goethe folgende Geisteshaltung: Er wollte die "Abkehr von den regelgebundenen Dramen der Franzosen hin zum Ausdruck des Natürlichen, im Leben wie in der Dichtung". Natur bedeutete für ihn die Ganzheit des menschlichen Charakters und eine allumfassende Einheit des Universums. Dazu zählte für meinen Schöpfer auch die Aufhebung von Gut und Böse. Der Mensch sollte sich von Heilsversprechen lossagen und realistisch denken, d.h. er sollte sich seinem Schicksal, für das Tod und Untergang charakteristisch sind, bewusst werden.
Meine Urdarstellung
Goethe arbeitete während der Jahre 1768 bis 1775 in Straßbourg und Frankfurt an meiner ersten Fassung und präsentierte Auszüge aus seinem Werk erstmals in Weimar vor einer Hofgesellschaft des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Der Handlungsverlauf weichte von der späteren Fassung erheblich ab. Es fehlten mehrere Szenen des ersten Teils (mein zweiter Monolog, "Osterspaziergang", "Hexenküche", "Walpurgisnacht", ...). Der zweite Teil war überhaupt noch nicht vorhanden. Die Tragödie existierte in dieser Form unverändert ca. 10 Jahre.
Ein Teil nach dem anderen...
An der dramatischen Darstellung meiner Persönlichkeit schrieb Goethe erst 1786 weiter. Er wollte die Tragödie für die Herausgabe einer Werksammlung vollenden, scheiterte aber an diesem Vorhaben. Erst in Italien, wohin er nach zehn Jahren in Weimar aufgebrochen war, fügte er dem Stück wieder mehrere Szenen hinzu. Es entstanden die Szenen "Hexenküche" und "Wald und Höhle". Außerdem wandelte er die Szene "Auerbachs Keller" von der Prosaform (= Darstellung ohne Verse) in die klassische Verssprache um und veränderte die Handlung dieser Szene auf die heutige Fassung. Versuche in den Jahren 1788/89, dieses Werk endgültig abzuschließen, schlugen fehl. Aus diesem Grunde veröffentlichte Goethe 1790 das Werk als Fragment. Danach ließ er es wieder sieben Jahre lang ruhen.
Einfluss Schillers
Erst auf Drängen Schillers hin, mit dem Goethe seit 1794 eine enge Freundschaft geschlossen hatte, verfasste Goethe 1797 die "Zueignung", das "Vorspiel auf dem Theater" und den "Prolog im Himmel".
In Briefen schrieb Schiller an den gemeinsamen Verleger Cotta:
Doch wieder kam Goethe zu keinem endgültigen Ende. Wenngleich er vermutlich kurz darauf erstmals den Plan fasste, die Dichtung über meine Wenigkeit auf zwei Teile verteilen.
... link